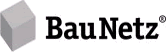- Weitere Angebote:
- Filme BauNetz TV
- Produktsuche
- Videoreihe ARCHlab (Porträts)
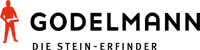
12.05.2025
Elefantenmist und Survival Kits
Zur Hauptausstellung der Architekturbiennale 2025 in Venedig

Kunst trifft auf Klimaanlage: Transsolar (2) und Michelangelo Pistoletto (3) gestalten den starken ersten Raum der Biennale. Die Abwärme der Geräte erinnert an die oft verdrängten Konsequenzen unserer heutigen Lebensweisen und das Wasserbecken von Pistoletto sorgt für eine leicht dystopische Stimmung. Beteiligt sind außerdem Bilge Kobas, Daniel A. Barber und Sonia Seneviratne.
Die von Carlo Ratti kuratierte Hauptausstellung der Architekturbiennale 2025 steht unter dem Titel „Intelligens. Natural. Artifical. Collective“. Die über 300 Beiträge reichen von Elefantenmist über Datengrafik und Roboter bis hin zum Atomreaktor. In mancherlei Hinsicht ist die Ausstellung problematisch, in ihrer Widersprüchlichkeit aber auch sehenswert. Nicht zuletzt stellt sie die Frage nach einem planerischen Selbstverständnis, das sich aktiv in die Gestaltung unserer Zukunft einbringt.
Text von Gregor Harbusch
Bildstrecke von Stephan Becker
So eindrucksvoll und zugleich dystopisch wie dieses Jahr hat schon lange keine Hauptausstellung der Biennale mehr begonnen. Eine dunkle Halle, mystisches Gegenlicht und die stickige Abwärme einer bedrohlichen Phalanx surrender Klimaanlagen empfangen die Besucher*innen im Arsenale. Wie wir momentan leben, ist nicht mehr akzeptabel, scheint uns Kurator Carlo Ratti mit diesem durchaus pathetischen Auftakt zuzurufen. Dafür hat er eine Inszenierung des Büros Transsolar mit einer Installation der Fondazione Pistoletto kombiniert.
Man findet sich hier gewissermaßen in der großmaßstäblichen Variante eines „Stressraumes“ wieder, wie man ihn auch im Deutschen Pavillon erleben kann, wo die Überhitzung urbaner Räume thematisiert wird. Auch Rattis Fokus liegt auf der Klimakrise, sein Credo ist eindeutig. Es genüge nicht mehr, dass sich die Architektur allein darauf konzentriert, ihren ökologischen Fußabdruck zu verringern, vielmehr müsse sie für eine veränderte Welt planen, betonte er Anfang des Jahres programmatisch.
Globale kollektive Intelligenz
Der 1971 geborene Turiner betreit das Büro Carlo Ratti Associati mit Niederlassungen in Turin, London und New York und lehrt am prestigeträchtigen Massachusetts Institute of Technology MIT sowie in Mailand. Er steht für ein wissenschaftlich und technologisch orientiertes Design- und Planungsverständnis, das optimistisch in die Zukunft blickt und keine Berührungsängste mit Wirtschaft und herrschender Politik hat. Ob man seinen Lösungsansatz teilt und was er für die gestaltenden Disziplinen bedeutet, ist sicherlich eine der obersten Fragen, mit der diese Biennale ihr Publikum konfrontiert.
Weil der Zentralpavillon in den Giardini wegen Sanierungsarbeiten dieses Jahr nicht bespielt werden konnte, konzentriert sich Rattis räumlich arg dichte, aber klar strukturierte Hauptausstellung auf das Arsenale. Die über 300 Beiträge ordnet er entlang der drei Formen von Intelligenz, die er im Titel der Ausstellung beschwört: natürlich, künstlich, kollektiv. Um eine wirklich breite Vielfalt zeigen zu können, hatte Ratti im Vorfeld einen offenen Aufruf namens Space for Ideas lanciert. So findet man unter den vielen Beiträgen auch Arbeiten weitgehend unbekannter, junger Planer*innen und Forscher*innen, die beispielsweise mit ihrer Abschlussarbeit gleichberechtigt neben etablierten Akteuren stehen.
Zwischen Elefantendung und Atomreaktoren
Im Ergebnis stehen dann Boonserm Premthadas Ziegel aus Elefantendung (die von der Jury mit einer Besonderen Erwähnung ausgezeichnet wurden), die Baubotanik des Münchner Office for Living Architecture, aber auch dezentrale Mini-Atomreaktoren von Pininfarina, newcleo und Fincantieri nebeneinander. Man trifft (selbstverständlich) auf Roboter, Bakterien und Myzele, historische und aktuelle Datenvisualisierungen und Unmengen neuer Materialien. Zuweilen erinnert die Ausstellung in diesem Bereich an eine Produktmesse. Wer wird am erfolgreichsten Prinzipien der Natur in marktgängige Produkte transformieren?
Zugleich kristallisiert sich in der vollen Bandbreite einer solch international angelegten Schau mit ihren vielen Beiträgen vielleicht eine neue Ästhetik des Bauens heraus. So zeigt ein Team um Lola Ben-Alon, was passiert, wenn man das vernakuläre Wissen um das Bauen mit Erde und Pflanzenfasern mit Künstlicher Intelligenz und 3D-Druck zusammenbringt. „Earthern Ritual“ nennt sich die eigentümliche Mischung aus High-Tech und afrikanischer Hütte.
Mensch oder Maschine?
Im Vorfeld betonte Ratti immer wieder, dass es auf seiner Biennale um Zahlen und nicht um schöne Bilder gehen werde, um den Menschen und nicht um Technologie. Man hört die Worte und mag sie angesichts der ausgestellten Beiträge doch nicht so ganz glauben.
Provokativ und als geradezu zynisch lesbar präsentiert sich etwa der Beitrag von BIG, der prominent am Anfang des Kapitels Collective gezeigt wird. Während der Eröffnungstage schnitzten hier zwei bhutanische Holzbildhauer in aller Ruhe an einem Balken, während hinter ihnen ein Roboter seine bereits abgeschlossene, KI-generierte, biomorphe Interpretation der traditionellen Schnitzkunst mit einem Pinsel streichelte. Dass darüber eine Hängebrücke der Protestbewegung aus dem Hambacher Forst hängt (die ursprünglich in der Ausstellung „Protest/Architektur“ im DAM in Frankfurt am Main gezeigt wurde), macht die Sache nicht besser.
Das Kapitel Collective – in dem nach all dem Technikzauber explizit gesellschaftliche Fragen angesprochen werden – ist der kürzeste und letzte der drei großen Abschnitte. „We are fucked! You can change it!“ ruft einem ein grelles Banner der Initiative HouseEurope! ganz am Ende entgegen. Daneben lädt eine Holztribüne zum niedrigschwelligen Diskursprogramm. Es folgt ein Epilog, den Ratti als Reflexion über die Fragilität und Einmaligkeit unseres Planeten verstanden wissen will. Man sieht sich konfrontiert mit dystopischer Survial-Ausrüstung und Modellen von Raumstationen, wie man sie seit Jahrzehnten aus der Science-Fiction kennt.
Dass sich Künstliche Intelligenz durch diese Biennale zieht, ist keine Überraschung. Ihre Anwendung spiegelt den Stand der Dinge wider. Sie schafft aber auch einen äußerst erhellenden Nebeneffekt. Denn Ratti und sein Team bringen auf jeder Texttafel ein „AI-Summary“, das zur schnellen Orientierung meist völlig genügt. In ihrer Kürze entlarven die KI-generierten Textchen die generelle Floskelhaftigkeit vieler Ausstellungstexte und helfen, die schiere Masse des Gezeigten zu bewältigen.
Diese Erkenntnis ist vermutlich mehr als eine editorische Randnotiz dieser Biennale, die gerade in ihrer Widersprüchlichkeit durchaus sehenswert ist. Sie liefert nicht nur eine Momentaufnahme der immensen Bandbreite an Ideen, die bei der Bewältigung der globalen ökologischen Herausforderungen helfen könnten. Sie sollte insbesondere als Manifestation eines planerischen Selbstverständnisses gelesen werden, das in der politischen Auseinandersetzung um die Gestaltung der Zukunft eine einflussreiche Rolle spielt.
Zum Thema:
Alle Beiträge zur Biennale finden sich auf unserer von der Firma Godelmann unterstützten Sonderseite.

Ohne Mikroben geht es nicht bei dieser Biennale, das verdeutlicht bereits die nächste Installation. The Other Side of the Hill (im Plan die Nummer 4) stellt die Ähnlichkeiten von menschlichem und bakteriellem Wachstum heraus. Beteiligt sind Beatriz Colomina, Roberto Kolter, Patricia Urquiola, Geoffrey West und Mark Wigley.

Nach dem Intro geht es los mit der Hauptausstellung: Carlo Ratti gliedert sie in die Abschnitte Natural, Artificial, Collective und Out. Die Strukturierung der Arbeiten ist dabei deutlich weniger prononciert als in den letzten Jahren. Gestaltet vom Berliner Büro Sub, herrscht eine Art hierarchieloses Durcheinander.

Zum Auftakt des Natural-Teils geht es immer wieder um Venedig als Fallstudie. Das Projekt FundamentAI (8) blickt auf das vielschichtige Ökosystem der Lagune und entwickelt daraus eine generative Design-Plattform für die Kollaboration zwischen menschlichen und nichtmenschlichen Spezies. Der etwas überspannte Anspruch ist nicht untypisch für die Projekte dieser Biennale. Beteiligt sind ecoLogicStudio, die Uni Innsbruck, Areti Markopoulou und das Post-Spectacular Office.