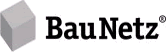https://www.baunetz.de/wettbewerbe/_Emanzipatorische_Wohnformen_Biesdorf-Sued_Marzahn_aktualisiert__97149.html
- Weitere Angebote:
- Filme BauNetz TV
- Produktsuche
- Videoreihe ARCHlab (Porträts)
Konkave Welle in Saint-Denis
Olympisches Wassersportzentrum von VenhoevenCS und Ateliers 2/3/4/
Patios und Kork
Wohnhaus in Madrid von Nunez Ribot Arquitectos
Sporthalle mit Reliefmauerwerk
Atelier . Schmelzer . Weber in Salzwedel
Eine Schublade voller Ideen
Zum Tod von Guobin Shen
Buchtipp: Sehnsuchtsorte im Postkartenformat
Check-in Check-out. Hotelfotografie der Kunstanstalt Brügger, Meiringen
Silo für norwegische Kunst
Umbau von Mestres Wage, Mendoza Partida und BAX studio in Kristiansand
Kulturquartier am Pumpwerk
Pläne für Wilhelmshaven von pbr Planungsbüro Rohling
Wettbewerbsaufgabe
Teil 3 Wettbewerbsaufgabe
3.01: Generelle Vorbemerkungen/Pramissen
Intention des Wettbewerbs Das Stichwort 'Architektinnen-Wettbewerb' ist geeignet, eine Fülle von Assoziationen hervorzurufen und unterschiedlichste Vorstellungen, vor allem Erwartungen, nicht zuletzt unerfüllbare auszulösen. De facto geht es hier um einen Wettbewerb, der - an Marktlage und Machbarkeit orientiert - als kombiniertes Verfahren den Anspruch und die Herausforderung stellt, zukunftsweisende Wohnkonzeptionen zu entwickeln und zu realisieren. Erwartet wird, daß die Entwürfe die Lebensbedingungen und Vorstellungen von Frauen berücksichtigen und Räume schaffen, die dazu beitragen, den Lebensalltag von Frauen zu erleichtem.
Dies soll auch durchgängiges Entwurfsprinzip sein - doch ist die eigentliche Thematik komplexer und geht darüber hinhaus, weil sich im Zuge der gesellschaftlichen Veränderungen - besonders mit zunehmender Auflösung der sog. Normalfamilie - mittlerweile eine Vielfalt von Lebens- und Haushaltssituationen herausgebildet hat, die insgesamt eine Veränderung der Anforderungen an die Wohnung und das Wohnumfeld bedingen. Nach wie vor sind sie jedoch Orte von Reproduktionsarbeit und Kindererziehung, und neben der Regenaration der Haushaltsmitglieder sind diese Funktionen besonders zu bedenken. Wenn diesen Anfordenungen Rechnung getragen wird und zugleich Raum für partnerschaftliche Alltagsbewältigung und individuelle Entwicklung gegeben ist, bedeutet das im Ergebnis, daß damit letztlich allen Wohnungszugehörigen gedient ist. Für den Wettbewerb wurde deshalb bewußt der eher umfassende Begriff 'emanzipatorische Wohnformen' gewählt.
Die Komplexität dieses Themas trifft hier auf die Größenordnung von zwei Baufeldern mit max. 90/95 Wohneinheiten in Miet- und Eigentumswohnungsbau und auf die ökonomische Notwendigkeit, trotz hoher Ansprüche, ein finanziell tragfähiges, gut vermarktbares Konzept im Rahmen kosten- und flächensparender Bauweise als ein von Anfang an gemeinsam - von Architektin und Bauträger (Bieter der Bauleistungen und Grundstückserwerber) - getragenes Konzept zu entwickeln.
Der Auslober erwartet ein hohes Gestaltniveau und erhofft Entwürfe, die den neuen Wohn- und Lebensverhältnissen angemessen sind - d.h. etwas Innovatives/Zukunftsweisendes, wozu nicht nur die Kreativität/das know how der Architektin gefordert ist, sondem vor allem die Bereitschaft der Bauträger, in gute Ideen zu investieren und ein Beispiel zu setzen.
3.02 Besonderheiten der Aufgabe und des Verfahrens: Mit dem Kombinierten Wettbewerb wird durch die frühzeitige Verknüpfung der planerischen Tätigkeit der Architektin mit den herstellungs- und vermarktungsorientierten Überlegungen des Bauträgers eine Optimierung des Planungs- und Herstellungsprozesses in rationeller Hinsicht erwartet, die für die Eigentumserwerber zu einer deutlichen Preissenkung gegenüber dem bisherigen Marktangebot führen soll.
3.03 Grundsatzliche stadtebaulich-architektonische Zielvorstellungen: Ziel dieses kombinierten Realisierungswettbewerbs mit typologischem Aufgabeninhalt sind preisgünstige Miet- und Eigentumswohnungen/Eigenheime für die beiden im stadtnahen Entwicklungsbereich Biesdorf-Süd, Ortsteil Habichtshorst, gelegenen und für diese Aufgabe ausgewählten Baufeider.
Aus mehreren, ggf. variierten Wohneinheiten eines Grundtyps sollten Hausgruppen gebildet werden können, die sich unterschiedlichen Nutzungsbedingungen anpassen und aus denen sich städtebauliche Stnukturen entwickeln lassen. Dabei wünscht sich der Auslober - auch bereits für diese kleineren Wohnquartiere - die Rückbesinnung auf urbane Prinzipien der Einheit von Stadt und Haus sowie der Differenzierung von öffentlichem und privatem Raum, da sie als Teil der Stadt und nicht als Teil des ländlichen Umlandes erkennbar sein sollen.
Somit sollte der typologische Gehalt der Planungsaufgabe und die verdichtete Lage der Häuser noch innerhalb der Stadt Auswirkungen auf die Architektur der Gebäude haben. Im Gegensatz zu eher dörflichen Anklängen im Umland ist hier ein städtisches Erscheinungsbild zu prägen, das auf Langlebigkeit hin angelegt ist.
Das städtebauliche Regelwerk (vgl. Entwicklungsplan im Anhang) sowie die im Bebauungsplan festgeschriebenen Gestaltungsvorschriften sind einzuhalten und im weiteren Verfahren abzustimmen. Das Regelwerk ist als generelle Vorgabe zu sehen, um das städtebauliche Gesamtbild des Teilgebietes Habichtshorst zu sichem.
3.04 Wohunutzungsspektrum: Kem der Wettbewerbsaufgabe ist die Entwicklung eines Grundtyps von ca. 100 qm Wohnfläche für 4- bis 5-Personen-Haushalte. Durch Modifikation oder Variation des Grundtyps sollen variable Wohnfommen ermöglicht werden, wie z.B.:
• Normalfamilienwohnen (Eltem mit zwei bis drei Kindem)
• Wohnen Alleinerziehender mit Kind/Kindern (auch als Gemeinschaft mit anderen Alleinerziehenden)
• Wohnen kinderreicher Familien
• Generationen-Wohnen bzw. Senioren- und
• getrenntes Einlieger-Wohnen im vorgenannten Grundtyp (in abgeschlossener Wohnung)
• Single-Wohnen
• Wohnen mit Arbeitsbereich
• Partnerschaffliches Wohnen
• Wohngemeinschaft
3.05 Emanzipatorische Wohnformen: Mit welchen räumlichen Konzepten der Vielfalt der praktizierten und zukünftigen Lebensformen und Haushaltssituationen in unterschiedlichen Lebensphasen im Rahmen der hier gegebenen Möglichkeiten am besten Rechnung getragen werden kann, iäßt sich nicht vorgeben und ist Gegenstand des Wettbewerbs.
Es gibt jedoch Aspekte bzw. Bedürfnisse, die für die Stnukturierung einer Wohnung/die Disposition eines Wohnungsgnundrisses von grundlegender Bedeutung sind, z.B. das Bedürfnis nach Individualität wie nach Gemeinsamkeit/Gemeinschaft, nach Rückzug wie nach Kontakt/Kommunikation.
Wesentlich erscheint das Grundbedürfnis - in welcher Konstellation auch immer; allein, zu zweit, zu mehreren - ein weitestgehend eigenständges/selbstbestimmtes Leben führen zu können.
Nicht nur - aber erst recht am Beispiel einer Mehrpersonen-Wohnung wird deutlich, wie wesentlich solche Aspekte für die Strukturierung und spätere Nutzbarkeit einer Wohnung sind, ob das Konzept dem Anspruch gerecht wird, eine emanzipatorische Wohnform zu ermöglichen.
Vor allem gilt es die Wohnungen so zu organisieren und räumliche Vorraussetzugen zu schaffen, daß sie der Erleichterung des Lebens- und Haushaltsalltags dienen, orientiert an Aufgaben wie
• generelle Versorgung/Fürsorge/Hausarbeit (die pro Person im Haushalt 2 Stunden täglich beansprucht)
• Aufziehen von Kindem/Pflege/Betreuung/Erziehung
• Zusammenleben mit Jugendlichen
• Betreuung/Pflege Kranker, besonders Älterer etc..
Generell geht es um die Entlastung im Zusammenleben von verschiedenen Menschen, um ein wortwörtlich 'soziales' Arrangement, d. h. u. a. Lastenverteilung/Kooperation, weg von der Rollenfixierung/mehr Gleichrangigkeit/Emanzipation, wozu es u. a. auch entsprechender räumlicher Vorraussetzungen bedarf.
Bei der Erarbeitung der Konzepte für verschiedene Haushaltsgrößen sollten u.a. folgende Aspekte Berücksichtigung finden:
Entwicklung einer Typologie mit Varianten, die eine Wohnungsflexibilität von der 1- bis zur 5-Zimmerwohnung emmöglicht.
Variabilität der Nutzung, z.B. durch
• möglichst gleich groBe, gleichwertige Individualäume, ohne funktionale Zuweisung
• Entfunktionalisierung und Enthierarchisierung von Wohnräumen
• ein räumliches Angebot für die Kombination von Kochen/Essen/Wohnen
• ein möglichst offenes Raumkontinuum, das Zonen wie Diele, Küche, EB-,
• Gemeinschafts- und Freiräume verbindet, wobei die Raum(ein)teilung/
• Wandstellung ggf. den Nutzerinnen/Nutzem überlassen werden kann
• Berücksichtigung gröBerer Geräumigkeit soweit möglich auch Spielbereiche für Kinder
• Kombination von Wohnen und Arbeiten
• Mehrfachnutzung Bad (zugleich Erholungs-/Hausarbeitsraum), natürlich belichtet und belüftet
• Trennung von Bad und WC
• zuschaltbare und unter Umständen verschließbare Freiräume wie Terrassen, Balkone, Loggien oder Wintergärten
• genügend Abstellplatz/Stauraum
Flexibilität der Räumlichkeiten (z. B. durch zuschaltbare/abtrennbare Flächen) um eine Anpaßbarkeit an wechselnde Lebensyklen der Bewohnerinnen und Bewohner zu gewährleisten.
Durchaus vorstellbar ist auch die Mischung von Wohnen und Gewerbeeinrichtungen (Allgemeines Wohngebiet, vgl. B-Plan) z. B. Kneipe, Cafe, Büro etc.
3.01: Generelle Vorbemerkungen/Pramissen
Intention des Wettbewerbs Das Stichwort 'Architektinnen-Wettbewerb' ist geeignet, eine Fülle von Assoziationen hervorzurufen und unterschiedlichste Vorstellungen, vor allem Erwartungen, nicht zuletzt unerfüllbare auszulösen. De facto geht es hier um einen Wettbewerb, der - an Marktlage und Machbarkeit orientiert - als kombiniertes Verfahren den Anspruch und die Herausforderung stellt, zukunftsweisende Wohnkonzeptionen zu entwickeln und zu realisieren. Erwartet wird, daß die Entwürfe die Lebensbedingungen und Vorstellungen von Frauen berücksichtigen und Räume schaffen, die dazu beitragen, den Lebensalltag von Frauen zu erleichtem.
Dies soll auch durchgängiges Entwurfsprinzip sein - doch ist die eigentliche Thematik komplexer und geht darüber hinhaus, weil sich im Zuge der gesellschaftlichen Veränderungen - besonders mit zunehmender Auflösung der sog. Normalfamilie - mittlerweile eine Vielfalt von Lebens- und Haushaltssituationen herausgebildet hat, die insgesamt eine Veränderung der Anforderungen an die Wohnung und das Wohnumfeld bedingen. Nach wie vor sind sie jedoch Orte von Reproduktionsarbeit und Kindererziehung, und neben der Regenaration der Haushaltsmitglieder sind diese Funktionen besonders zu bedenken. Wenn diesen Anfordenungen Rechnung getragen wird und zugleich Raum für partnerschaftliche Alltagsbewältigung und individuelle Entwicklung gegeben ist, bedeutet das im Ergebnis, daß damit letztlich allen Wohnungszugehörigen gedient ist. Für den Wettbewerb wurde deshalb bewußt der eher umfassende Begriff 'emanzipatorische Wohnformen' gewählt.
Die Komplexität dieses Themas trifft hier auf die Größenordnung von zwei Baufeldern mit max. 90/95 Wohneinheiten in Miet- und Eigentumswohnungsbau und auf die ökonomische Notwendigkeit, trotz hoher Ansprüche, ein finanziell tragfähiges, gut vermarktbares Konzept im Rahmen kosten- und flächensparender Bauweise als ein von Anfang an gemeinsam - von Architektin und Bauträger (Bieter der Bauleistungen und Grundstückserwerber) - getragenes Konzept zu entwickeln.
Der Auslober erwartet ein hohes Gestaltniveau und erhofft Entwürfe, die den neuen Wohn- und Lebensverhältnissen angemessen sind - d.h. etwas Innovatives/Zukunftsweisendes, wozu nicht nur die Kreativität/das know how der Architektin gefordert ist, sondem vor allem die Bereitschaft der Bauträger, in gute Ideen zu investieren und ein Beispiel zu setzen.
3.02 Besonderheiten der Aufgabe und des Verfahrens: Mit dem Kombinierten Wettbewerb wird durch die frühzeitige Verknüpfung der planerischen Tätigkeit der Architektin mit den herstellungs- und vermarktungsorientierten Überlegungen des Bauträgers eine Optimierung des Planungs- und Herstellungsprozesses in rationeller Hinsicht erwartet, die für die Eigentumserwerber zu einer deutlichen Preissenkung gegenüber dem bisherigen Marktangebot führen soll.
3.03 Grundsatzliche stadtebaulich-architektonische Zielvorstellungen: Ziel dieses kombinierten Realisierungswettbewerbs mit typologischem Aufgabeninhalt sind preisgünstige Miet- und Eigentumswohnungen/Eigenheime für die beiden im stadtnahen Entwicklungsbereich Biesdorf-Süd, Ortsteil Habichtshorst, gelegenen und für diese Aufgabe ausgewählten Baufeider.
Aus mehreren, ggf. variierten Wohneinheiten eines Grundtyps sollten Hausgruppen gebildet werden können, die sich unterschiedlichen Nutzungsbedingungen anpassen und aus denen sich städtebauliche Stnukturen entwickeln lassen. Dabei wünscht sich der Auslober - auch bereits für diese kleineren Wohnquartiere - die Rückbesinnung auf urbane Prinzipien der Einheit von Stadt und Haus sowie der Differenzierung von öffentlichem und privatem Raum, da sie als Teil der Stadt und nicht als Teil des ländlichen Umlandes erkennbar sein sollen.
Somit sollte der typologische Gehalt der Planungsaufgabe und die verdichtete Lage der Häuser noch innerhalb der Stadt Auswirkungen auf die Architektur der Gebäude haben. Im Gegensatz zu eher dörflichen Anklängen im Umland ist hier ein städtisches Erscheinungsbild zu prägen, das auf Langlebigkeit hin angelegt ist.
Das städtebauliche Regelwerk (vgl. Entwicklungsplan im Anhang) sowie die im Bebauungsplan festgeschriebenen Gestaltungsvorschriften sind einzuhalten und im weiteren Verfahren abzustimmen. Das Regelwerk ist als generelle Vorgabe zu sehen, um das städtebauliche Gesamtbild des Teilgebietes Habichtshorst zu sichem.
3.04 Wohunutzungsspektrum: Kem der Wettbewerbsaufgabe ist die Entwicklung eines Grundtyps von ca. 100 qm Wohnfläche für 4- bis 5-Personen-Haushalte. Durch Modifikation oder Variation des Grundtyps sollen variable Wohnfommen ermöglicht werden, wie z.B.:
• Normalfamilienwohnen (Eltem mit zwei bis drei Kindem)
• Wohnen Alleinerziehender mit Kind/Kindern (auch als Gemeinschaft mit anderen Alleinerziehenden)
• Wohnen kinderreicher Familien
• Generationen-Wohnen bzw. Senioren- und
• getrenntes Einlieger-Wohnen im vorgenannten Grundtyp (in abgeschlossener Wohnung)
• Single-Wohnen
• Wohnen mit Arbeitsbereich
• Partnerschaffliches Wohnen
• Wohngemeinschaft
3.05 Emanzipatorische Wohnformen: Mit welchen räumlichen Konzepten der Vielfalt der praktizierten und zukünftigen Lebensformen und Haushaltssituationen in unterschiedlichen Lebensphasen im Rahmen der hier gegebenen Möglichkeiten am besten Rechnung getragen werden kann, iäßt sich nicht vorgeben und ist Gegenstand des Wettbewerbs.
Es gibt jedoch Aspekte bzw. Bedürfnisse, die für die Stnukturierung einer Wohnung/die Disposition eines Wohnungsgnundrisses von grundlegender Bedeutung sind, z.B. das Bedürfnis nach Individualität wie nach Gemeinsamkeit/Gemeinschaft, nach Rückzug wie nach Kontakt/Kommunikation.
Wesentlich erscheint das Grundbedürfnis - in welcher Konstellation auch immer; allein, zu zweit, zu mehreren - ein weitestgehend eigenständges/selbstbestimmtes Leben führen zu können.
Nicht nur - aber erst recht am Beispiel einer Mehrpersonen-Wohnung wird deutlich, wie wesentlich solche Aspekte für die Strukturierung und spätere Nutzbarkeit einer Wohnung sind, ob das Konzept dem Anspruch gerecht wird, eine emanzipatorische Wohnform zu ermöglichen.
Vor allem gilt es die Wohnungen so zu organisieren und räumliche Vorraussetzugen zu schaffen, daß sie der Erleichterung des Lebens- und Haushaltsalltags dienen, orientiert an Aufgaben wie
• generelle Versorgung/Fürsorge/Hausarbeit (die pro Person im Haushalt 2 Stunden täglich beansprucht)
• Aufziehen von Kindem/Pflege/Betreuung/Erziehung
• Zusammenleben mit Jugendlichen
• Betreuung/Pflege Kranker, besonders Älterer etc..
Generell geht es um die Entlastung im Zusammenleben von verschiedenen Menschen, um ein wortwörtlich 'soziales' Arrangement, d. h. u. a. Lastenverteilung/Kooperation, weg von der Rollenfixierung/mehr Gleichrangigkeit/Emanzipation, wozu es u. a. auch entsprechender räumlicher Vorraussetzungen bedarf.
Bei der Erarbeitung der Konzepte für verschiedene Haushaltsgrößen sollten u.a. folgende Aspekte Berücksichtigung finden:
Entwicklung einer Typologie mit Varianten, die eine Wohnungsflexibilität von der 1- bis zur 5-Zimmerwohnung emmöglicht.
Variabilität der Nutzung, z.B. durch
• möglichst gleich groBe, gleichwertige Individualäume, ohne funktionale Zuweisung
• Entfunktionalisierung und Enthierarchisierung von Wohnräumen
• ein räumliches Angebot für die Kombination von Kochen/Essen/Wohnen
• ein möglichst offenes Raumkontinuum, das Zonen wie Diele, Küche, EB-,
• Gemeinschafts- und Freiräume verbindet, wobei die Raum(ein)teilung/
• Wandstellung ggf. den Nutzerinnen/Nutzem überlassen werden kann
• Berücksichtigung gröBerer Geräumigkeit soweit möglich auch Spielbereiche für Kinder
• Kombination von Wohnen und Arbeiten
• Mehrfachnutzung Bad (zugleich Erholungs-/Hausarbeitsraum), natürlich belichtet und belüftet
• Trennung von Bad und WC
• zuschaltbare und unter Umständen verschließbare Freiräume wie Terrassen, Balkone, Loggien oder Wintergärten
• genügend Abstellplatz/Stauraum
Flexibilität der Räumlichkeiten (z. B. durch zuschaltbare/abtrennbare Flächen) um eine Anpaßbarkeit an wechselnde Lebensyklen der Bewohnerinnen und Bewohner zu gewährleisten.
Durchaus vorstellbar ist auch die Mischung von Wohnen und Gewerbeeinrichtungen (Allgemeines Wohngebiet, vgl. B-Plan) z. B. Kneipe, Cafe, Büro etc.