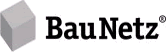- Weitere Angebote:
- Filme BauNetz TV
- Produktsuche
- Videoreihe ARCHlab (Porträts)
18.06.2025
Zwischen Zerstörung, Erinnerung und Resilienz
Bericht aus der Weißen Stadt in Tel Aviv
Von Sharon Golan
In den letzten Nächten erinnerte der Himmel über Tel Aviv an eine Szene aus dem Film Star Wars. Wie glühende Kometen jagten todbringende Raketen durch die Wolken, während die Abfangraketen des Iron Dome als blaue Blitze in eleganten Bögen vom Boden aufstiegen, um sie noch in der Luft zu neutralisieren.
Gegen 4 Uhr morgens saß ich – zum dritten Mal in dieser einen Nacht – im Pyjama mit meinem Nachbarn im Schutzraum. Mein Haus, gebaut 1934, steht im Herzen der sogenannten Weißen Stadt in Tel Aviv. Das Stadtviertel entstand in den 1930er Jahren nach einem Masterplan des schottischen Stadtplaners Patrick Geddes, der sich am Vorbild einer Gartenstadt orientiert hatte. 2003 erkannte es die UNESCO als Weltkulturerbe an. Mit rund 4.000 modernistischen Bauten ist die Weiße Stadt das größte Ensemble seiner Art weltweit.
Offene, pluralistische Stadt
Geplant und gebaut wurden die weißen kubischen Häuser in den 1930er Jahren vor allem von deutschsprachigen Immigrant*innen, die in Israel einen Neuanfang suchten. Sie flohen vor Verfolgung und Nationalsozialismus und brachten die Vision mit, eine moderne, offene, pluralistische Stadt zu errichten. Die Architektursprache, für die sie sich entschieden, war die der Neuen Sachlichkeit: schlicht, funktional, zukunftsorientiert. Prinzipien und progressive Ideen des Bauhauses, das 1933 von den Nazis aufgelöst worden war, lebten hier weiter.
Die in Architektur und Stadtplanung übertragene reformerische Weltanschauung spürt man bis heute. In dieser pluralistischen Stadt kannst du sein, wer du bist – mit ihrem rasanten, opulenten Lebensstil heißt sie alle willkommen. Ihre Proportionen schaffen ein Gleichgewicht zwischen Natur und Mensch, zwischen gebauter Struktur und Straße. Dank passiver Belüftungsstrategien sind die Häuser perfekt an die klimatischen Bedingungen der Levante angepasst. Balkonbänder gliedern mit langen horizontalen Linien die Fassaden und begleiten Fußgänger*innen in ihrem Rhythmus durch die Straßen.
Das Liebling Haus
Um dieses gemeinsame deutsch-israelische Erbe zu bewahren, entstand vor zehn Jahren das Liebling Haus als Besucherzentrum für die Weiße Stadt. Das Projekt entsprang einer Kooperation des deutschen Bundesbauministeriums mit der Stadt Tel Aviv und wurde 2019, im Jahr des 100-jährigen Gründungsjubiläums des Bauhauses, feierlich eröffnet. Seitdem ist das Liebling Haus eine Plattform für Forschung und Ausstellungen, ein Ort des Austauschs zu Architektur, Denkmalpflege und Stadtplanung.
Errichtet wurde das Haus, das zu den bedeutendsten Bauten der Weißen Stadt zählt, im Jahr 1936 durch Dov Karmi, der 1957 als Erster den Israel-Preis erhielt, die höchste Kulturauszeichnung des Landes. Karmi war stark beeinflusst vom belgischen Architekten Henry van de Velde, einem Wegbereiter des Bauhauses, bei dem er an der Universität Gent studiert hatte.
Das dreigeschossige Gebäude besteht aus einem Hauptvolumen, das parallel zur Straße verläuft, und einem kleineren, nach hinten versetzten Baukörper. In der Zwischenzone der beiden Kuben liegt eine markante Eingangspergola. Sie bildet eine durchgrünte, klimatisch wirksame Übergangszone zwischen der Öffentlichkeit der Straße und der geschützten Intimität des privaten Eingangsbereichs. Diese Gliederung ist ein typisches Element der Tel Aviver Moderne.
Die Staffelung der Baukörper wurde bewusst gewählt, um mehr Außenfläche zu schaffen und damit größere Fensteröffnungen für eine effektive Querlüftung zu ermöglichen. Die Hauptfassade folgt in ihren Proportionen dem Goldenen Schnitt, der, wie bei vielen Gebäuden der Epoche, ein wichtiges Gestaltungselement war. Die langgezogenen Balkone, die die Straßenfassade prägen, sind so dimensioniert, dass sie direkte Sonneneinstrahlung in den Innenräumen reduzieren – eine Anpassung von Le Corbusiers Konzept der Fensterbänder an das mediterrane Klima.
Sanitärräume und Küche befinden sich im Zentrum des Gebäudes nahe dem Treppenhaus. Sie sind in einen rückwärtigen Schacht verlegt, um direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden. Besonders bemerkenswert ist die Gestaltung der Küche, die sich an den funktionalen Prinzipien der Frankfurter Küche orientiert – mit einem entscheidenden Unterschied: Nicht der Herd, sondern der Kühlschrank bildet den Mittelpunkt.
Eine angrenzende Loggia diente der Belüftung. Hier wurde beispielsweise Gemüse in Schränken mit Holzlamellen aufbewahrt oder schmutzige Wäsche zwischengelagert. Jede Wohnung verfügte somit über zwei Balkone. Dieses architektonische Konzept erhöht nicht nur den Wohnkomfort, sondern steht exemplarisch für den funktionalen, klimagerechten und sozialen Anspruch der modernen Architektur jener Zeit.
Der Genius Loci lebt weiter
Wenn Sie sich fragen, warum das Haus „Liebling Haus“ heißt: Es wurde der Stadt von Frau Toni Liebling geschenkt, seiner früheren Besitzerin, die im dritten Stock lebte. Ihr Wunsch war es, das Gebäude als Museum, Kindertagesstätte oder Studierendenheim der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Den liebenswürdigen Geist von Frau Liebling spürt man im Haus bis heute. Im Erdgeschoss, wo einst Dr. Meyer wohnte, ein Berliner Arzt, der aus dem nationalsozialistischen Deutschland nach Tel Aviv emigrierte, befindet sich jetzt ein lebendiges Café. Es ist ein beliebter Treffpunkt der kreativen Szene und lässt das Haus zu einem offenen, vielfältigen Gemeinschaftsort werden – ganz im Sinne von Frau Liebling.
Als wir das Gebäude zum öffentlichen Besucherzentrum umbauen ließen, wurde es mit äußerster Sorgfalt restauriert, vom Terrazzoboden über die Holzfenster bis hin zu originalen Lichtschaltern und Türgriffen. Wir dokumentierten Erinnerungen ehemaliger Bewohner*innen, fanden Spuren der Vergangenheit: Das Haus erzählte uns seine Geschichte. Die Renovierungsphase selbst gestalteten wir unter dem Titel „Open for Renovation“ als eine Art Bauhütte – ein offenes Werkstattformat, zu dem wir Handwerker*innen aus Deutschland einluden, um ihre Expertise nach Tel Aviv zu bringen. So wollten wir auch die Tradition wiederbeleben, in der die Weiße Stadt einst erbaut wurde. Auf der Baustelle arbeiteten deutsche, arabische sowie jüdische Studierende und Auszubildende zusammen. Im gemeinsamen Tun, durch das Handwerk, lernten sie einander jenseits von Sprache, Herkunft oder Geschichte kennen.
In jener Nacht vor drei Tagen, die ich im Schutzraum verbrachte, schlug ein iranisches Geschoss etwa 50 Meter vom Liebling Haus entfernt ein und beschädigte mehrere denkmalgeschützte Bauten. Die Explosion der ballistischen Rakete, die zwischen 500 Kilo und einer Tonne wiegt und eine Sprengkraft hat, die ganze Straßenzüge verwüsten kann, zerstörte Fenster, Türen, Putz und Mauerwerk des Liebling Hauses. Viele historische Spuren wurden damit vernichtet. Und dennoch: Wir hatten Glück. Das Haus steht noch, sein Genius Loci lebt weiter. Die bauliche Substanz im Inneren ist unversehrt. Und die zertrümmerten Teile? Sie werden nicht ersetzt, sie werden geflickt. Wir rekonstruieren nicht, wir reparieren.
Auch diese Nacht geht in die Geschichte des Gebäudes ein und hinterlässt ihre Spuren. Die Schäden erinnern uns daran, wie fragil das vermeintlich Beständige ist – aber vielleicht stärken gerade diese Erkenntnis und auch der Akt des Reparierens unsere Resilienz.
Fotos: Yael Schmidt, Sharon Golan
Zum Thema:
In der Baunetzwoche #570 sprachen wir mit der Fotografin Irmel Kamp, die über viele Jahre hinweg das modernistische Bauerbe Tel Avivs mit ihrer Kamera dokumentiert hat.
Der Verlag Jovis publizierte 2012 Tel Aviv – White City mit Fotografien von Stefan Boness. 2024 erschien das Buch Das Liebling Haus, das von Sharon Golan mitherausgegeben wurde. Von der Autorin erschien bei DOM Publishers der Architekturführer zu Tel Aviv.
Dieses Objekt & Umgebung auf BauNetz-Maps anzeigen:


Zerstörungen im Liebling Haus in Tel Aviv nach der Explosion einer iranischen Bombe unweit des Gebäudes, aufgenommen am 17. Juni.

Auch andere Bauten in der Weißen Stadt wurden stark beschädigt.

Liebling Haus am 17. Juni 2025

Liebling Haus am 17. Juni 2025
Bildergalerie ansehen: 18 Bilder