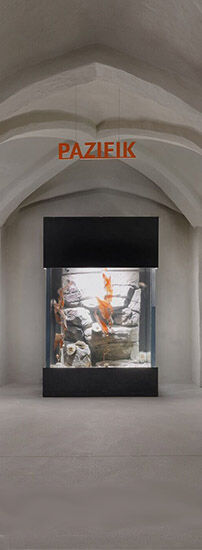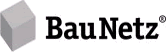- Weitere Angebote:
- Filme BauNetz TV
- Produktsuche
- Videoreihe ARCHlab (Porträts)
04.06.2025
Buchtipp: Frei Otto
1925–2015. Bauen mit der Natur
Frei Otto war seiner Zeit in vielem voraus. Bereits in den 1950ern entwickelte der Pionier des leichten Flächentragwerks Konzepte, die dem heutigen Anspruch an nachhaltiges Bauen erstaunlich nahekommen. Sein interdisziplinärer Ansatz verband Architektur, Naturwissenschaften und Humanbiologie – immer mit dem Ziel, möglichst leicht, effizient und ressourcenschonend zu bauen. Mitunter zog er sogar das Nicht-Bauen dem Bauen vor – eine Haltung, von der seine Tochter in einem Vortrag berichtete. Was damals auf wenig Verständnis stieß, wirkt heute visionär und dringlicher denn je.
Zehn Jahre nach seinem Tod rückt die Publikation Frei Otto: 1925–2015. Bauen mit der Natur den weitsichtigen Ansatz des Pritzker-Preisträgers erneut ins Licht. Herausgegeben von Joaquín Medina Warmburg und Anna-Maria Meister, widmet sich der reich bebilderte Band auf 256 Seiten nicht nur Ottos filigranen Konstruktionen, sondern auch seinen Visionen von ökologischem Bauen, Bionik, Selbstbau und partizipativer Planung.
Viel wurde bereits über Ottos Werk berichtet. Nicht zuletzt durch die Ehrung mit dem Pritzkerpreis 2015 erhielt der Architekt national und international Anerkennung. Bis heute bleibt die posthume Auszeichnung nur einen Tag nach seinem Tod die einzige Ausnahme in der Geschichte des Preises. Seitdem wurden seine Arbeiten umfangreich präsentiert, etwa in der Ausstellung „Frei Otto. Denken in Modellen“, die erstmals die Modelle von Frei Otto veröffentlichte. Erst kürzlich wurden außerdem drei originale Membranschirme aus dem Nachlass des Architekten in Stuttgart gezeigt. Die vorliegende Publikation geht jedoch über die reine Projektschau und Biographie hinaus.
In drei Kapiteln, die je den Bereichen „Natur“, „Technik“ und „Gesellschaft“ zugeordnet sind, sollen die Heterogenität, aber auch die Widersprüchlichkeit in Ottos Werk betrachtet werden. Man wolle eine „Diskussion anstoßen, mit Ansätzen, die von der empirischen Technikgeschichte bis zur kritischen Diskursanalyse reichen“, heißt es im Vorwort. Dies leisten in erster Linie begleitende Essays, die neben der klassischen Projektvorstellung mit neun unterschiedlichen Arbeiten Ottos Werk nicht nur in einen größeren Kontext stellen, sondern auch kritisch beleuchten.
Selbstverständlich finden seine weithin bekannten, ikonischen Konstruktionen ihren Platz: das Sternwellenzelt in Köln (1957), das Seilnetzdach der Olympiastätten in München (1972) und der Deutsche Pavillon auf der Expo in Montreal (1967) – umfangreich bebildert mit Originalfotografien und Detailaufnahmen. Natürlich ist auch die Multihalle Mannheim (1975) dabei, deren Zukunft lange ungewiss war, die nun aber saniert und neu programmiert wird. Aber auch nicht ganz so prominente Werke werden vorgestellt, darunter die Ökohäuser am Berliner Tiergarten und ein Ensemble aus Kirche, Gemeindezentrum, Kindergarten und Glockenturm in Berlin-Zehlendorf – ein Frühwerk, das Otto zusammen mit Ewald Bubner realisierte. Mit der Projektstudie „Stadt in der Arktis“ wird zudem ein ungebautes, utopisch anmutendes Projekt gezeigt, das Otto 1971 als Prototyp einer überkuppelten Stadt für Regionen innerhalb der Polarkreise entwickelte.
Abgerundet wird der Band durch zwei ausführliche Interviews. Im ersten sprechen Jan Knippers, beratender Ingenieur und Leiter des Instituts für Tragkonstruktionen und Konstruktives Entwerfen (ITKE) an der Universität Stuttgart, und Achim Menges, Leiter des Instituts für Computerbasiertes Entwerfen und Baufertigung an der Universität Stuttgart, darüber, wie Ottos Arbeiten zentrale Bezugspunkte für das eigene Schaffen bilden. Im zweiten Gespräch berichtet Ferdinand Ludwig, Professor für Green Technologies in Landscape Architecture an der TU München und Gründer des Forschungsgebiet Baubotanik – das architektonische Konzepte mit lebenden Pflanzen untersucht – über seine Anknüpfungspunkte.
Frei Otto sei nicht nur Architekt, sondern auch Forscher, Erfinder, Form-Finder, Ingenieur, Baumeister, Lehrer, Mitarbeiter, Umwelt-Aktivist, Humanist und Schöpfer unvergesslicher Gebäude und Orte, begründete die Jury des Pritzker Preises damals ihre Wahl. Diese Vielfalt spiegelt sich auch in den Projekten des vorliegenden Bandes wider, denen allesamt diese gewisse Otto’sche Leichtigkeit innewohnt. Ob diese mit seinem Namen zusammenhängt, bleibt Spekulation: „Frei“ wurde ihm von seiner Mutter als Lebensmotto mitgegeben.
Text: Dorit Schneider-Maas
Frei Otto: 1925–2015. Bauen mit der Natur
Joaquín Medina Warmburg und Anna-Maria Meister (Hg.)
256 Seiten
Prestel Verlag, München 2025
ISBN 978-3-7913-7749-0
59 Euro
Kommentare:
Meldung kommentieren

Frei Otto am Modell für die Überdachung der Olympiaschwimmhalle in München (ca. 1970)

Multihalle in Mannheim 1975, Blick über die künstliche Wasserfläche auf die Terrasse des Restaurants

Stadt in der Antarktis (1953), Entwurfsskizze

Deutscher Pavillon auf der Expo 67 in Montreal 1967, Wettbewerbsplan: Grundriss Zwischen- und Obergeschoss
Bildergalerie ansehen: 11 Bilder