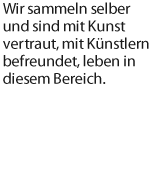Interview
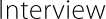

Die drei bisher bekanntesten Projekte von Kuehn Malvezzi sind Umbauten ehemaliger Industriegebäude in Ausstellungsräume für zeitgenössische Kunst. Sind alte Lagerhallen die besseren Museen?
Die Lagerhalle kommt als Loft von den Künstlerateliers, als Idee eines freien, einfachen, universalen Raums. Ausstellungsräume für Kunst wurden immer schon durch deren Produktionsräume geprägt, deshalb ist es für zeitgenössische Kunst natürlicher, in einer Industriehalle ausgestellt zu werden als in einem Museum.
Welche Art Raum braucht die heutige Kunst?
Es gibt nicht den einen Idealraum. Ich glaube, er muss möglichst nah an dem Raum sein, der der Produktion zugrunde liegt. Wieder anknüpfend ans Thema: Anfang des 20. Jahrhunderts haben wir die zenital belichteten Ateliers der Künstler, darauf folgend haben wir auch die ersten Galerien, die so funktionieren. Heute wird Kunst auch unter büroähnlichen Umständen erzeugt. Nicht nur Medienkunst, auch für Installationen und Skulpturen werden Konzepte und Vorlagen am Computer erarbeitet und dann umgesetzt. Man müsste also radikalerweise sagen: Heutige Kunst sollte in büroähnlichen Situationen ausgestellt werden. Man sehnt sich immer mehr nach der Trivialität und der Normalität eines Büroraums, die Heroik eines Industriebaus ist nicht mehr so interessant.
Eure Ausstellungsräume sind weitgehend eigenschaftslose, «stille» Räume, die ganz hinter die Exponate zurücktreten. Es bleiben sehr wenige Orte, euch als Architekten zu artikulieren. Bei den Rieckhallen ist es die Passerelle vom Hamburger Bahnhof hinüber, bei der Documenta waren es die Gänge mit einem wiederkehrenden Bankelement. Ist es das, was in eurem Konzept für «Architektur» übrig bleibt?
Ja, aber ich fasse das nicht negativ auf. Für mich sind die wesentlichen Aufgaben von Architektur: Bewegung im Raum, Parcoursbildung und das Narrative der Raumfolge. Und diese Dinge entwickeln sich in einem Ausstellungsraum mit einer demonstrativen Genauigkeit, einer Dramatik.

Wenn ich eine Ausstellung nicht in der Zeit denke, droht sie mir in eine Art Messe zu zerfallen, wo Stand neben Stand steht und um Aufmerksamkeit buhlt. Eine Ausstellung ist nicht als Konkurrenzveranstaltung konzipiert, sondern als ein dialogisches Moment zwischen verschiedenen Ereignissen. Die Zeiterfahrung im Raum ist aus unserer Sicht die Grundbedingung jeder Architektur, egal ob Schule, Krankenhaus oder Ausstellung. Das ist nicht wenig, sondern sehr viel, denn eine Ausstellung ist das Raummodell schlechthin.
Nun hat ein Gebäude nicht nur Innenräume, sondern auch ein Außen und eine irgendwie geartete Repräsentation. Der Umbau für die Friedrich Christian Flick Collection wurde beschrieben als «bescheiden» und «billig» – und ist das Museum eines der reichsten Kunstsammler unserer Zeit. Ist das nicht ein kapitaler Widerspruch?
In einem Ausstellungsraum für Kunst stört der Marmor, stört die Bronze, stört das ganze architektonische Aufwertungsszenario. Für die Kunst brauche ich Räume, räumliche Klarheit, und die erreiche ich nicht durch Material. Ich kenne genug Künstler, die in den Boom-Museen der 1980er und 1990er Jahre nicht gerne ausstellen, weil es sehr schwierig ist, mit solchen Räumen in Dialog zu treten. Sie haben eine eigenartige Form von Dominanz und Repräsentationsgehabe. Ich glaube Repräsentation ist für Kunst keine günstige Voraussetzung. Es ist immer besser, man versucht die direktest mögliche Präsentationsform zu schaffen. Unvermittelt! Jede Vermittlung durch repräsentative Techniken schafft Distanz und schafft auch ein Stück Musealisierung im Sinne von Abtötung der Kunst.
Auch eine Fassade aus Trapezblech repräsentiert etwas.
Sie hat eine Aussage, aber keine rhetorische, keine primär repräsentative Aussage. Sie sagt: Wir wollen mit dem geringsten Aufwand etwas erreichen. Das ist etwas, das in der konzeptuellen Kunst eine wichtige Rolle spielt: die Direktheit der Aussage. In der Kunst kann ich mit Rhetorik nichts erreichen, nur durch direkte konzeptuelle Schritte. Konzeptuelle Kunst ist ein Vorbild für den präzisen Einsatz der Mittel. Und auch dafür, dass «autonome Form» nicht heißt, expressiv zu sein. Eine autonome Form kann gleichzeitig eine sehr gelassene, fast unsichtbare Form sein. Das kann man bei Donald Judd lernen, man kann es aber auch von den Architekten Alison und Peter Smithson lernen: Direktheit der Mittel und Freiheit von Rhetorik.
Daraus folgert, dass es auch keinen Unterschied mehr gibt zwischen dem hehren Kulturraum eines Museums und einem kommerziellen Galerieraum.
Genau. Der Unterschied zwischen dem Museum, der Galerie, dem Produktionsraum und übrigens auch dem Archiv ist komplett ins Schwimmen geraten. Zum Glück. Man kann die Räume miteinander tauschen.

Weshalb ja viele Museen mittlerweile ihre «project spaces» haben und an Orten arbeiten, die nicht museal sind, und es auch Künstler gibt, die ihr Studio in ein Museum installieren. Interessant wird es dann, wenn auch noch das Wohnen, der Privatraum mit hinein kommt, wie hier in der Stoschek Collection.
Eine andere Vermischung der Sphären ist das Schaulager in Basel. Man verglich die Haltung eurer Ausstellungsräume mit denen von Herzog & de Meuron, nannte es «modest minimalism». Eure Projekte kennzeichnet eine Art Rationalismus, das Interesse an Typologien, eine Lust an langen Räumen und Volumen, auch die Lust am Verbergen. Wie würdest du eure architektonischen Interessen beschreiben?
Die Idee, ein starkes Modell, einen starken Typus zu finden, den man auf eine konkrete Situation appliziert, mit der er erstmal nichts zu tun hat – das ist die Grundidee jeder unserer Interventionen. Nichts entwickelt sich einfach so aus der Situation heraus, organisch. Man kommt immer mit einer Idee im Kopf, mit bestimmten Vorstellungen, also bringen wir diese Idee ein: ein Labyrinth. Oder eine Rennbahn. Wir gehen immer von einer starken Vorstellung aus. Ungers Denken und Entwerfen in Bildern und Vorstellungen ist hier sicher grundlegend. Aber dann gilt es gleichzeitig, die Situation am Ort genau zu beobachten, aus ihr Schlüsse zu ziehen, versuchen zu verstehen, was sie bedeutet und zu fragen: Wie kommt die Situation mit diesem reinen Modell zurande? Die Typologie trifft auf die Lust am Pragmatischen, Eigenartigen, Situativen, auch total Unprogrammierten, etwas, das sich ergibt, wenn Menschen zusammen kommen, wie ein spontanes Gespräch. Für viele ist das ein Widerspruch: Rationalisten sind nicht situativ und jemand der organisch denkt, hat eine Aversion gegen klare Formen. Unser Approach ist es, diese Systeme miteinander zu vernetzen, die Widersprüche auszuhalten und genau daraus den Entwurf zu entwickeln.

Ihr wagt diesen Spagat und das ausgerechnet in Berlin, wo die beiden von dir geschilderten Pole scheinbar unvereinbare Fronten bilden. Zeigt sich hieran, dass eure Bildung an anderen Orten, unter unterschiedlichsten Einflüssen stattgefunden hat? Beispielsweise in Mailand und Wien.
Es ist richtig, dass wir vom Mailänder Rationalismus sehr beeinflusst sind, aber auch von der Architektur Portugals, wo wir auch studiert haben, von der Porto-Schule, vor allem von Alvaro Siza. Dort ging es natürlich um Kontextualisierung, aber es ging immer auch um ein gesellschaftliches Modell,

um Partizipation. Die Portugiesen haben den italienischen Rationalismus sehr stark rezipiert und in etwas Organisches umgewandelt. Das war für uns prägend. Wien war es übrigens auch. Ich habe mit Adolf Krischanitz gearbeitet – auch jemand, der es versteht, aus einer Konzeptualisierung von Fragestellungen heraus Architektur zu machen und nicht aus Vorlieben. Und ich schätze Hermann Czech sehr, weil er es immer wieder schafft, konzeptionelle Manierismen zu erzeugen.
Hermann Czech wird – sehr zu seinem Missfallen – als Gasthaus-Architekt gehandelt. Dazu sagte er mal: «Man darf nicht zu gut sein auf einem Gebiet, sonst nimmt man das nicht als Konzept, sondern als Metier.» Kuehn Malvezzi gelten als Architekten der Kunstszene. Macht euch das Bauchschmerzen?
Nein, mir würde das Restaurant-Gewerbe mehr Bauchschmerzen machen! Im Ernst: Wir wollen nicht als reine Ausstellungsarchitekten gehandelt werden und sind es auch nicht. Wir haben eine Schule gebaut, wir bauen gerade ein Hotel, wir haben einige Wohnhäuser gebaut. Die Themen, die wir dabei erforschen, sind die gleichen.
Das heißt, ihr vermarktet euch auch nicht gezielt als Architekten für die Kunstszene?
Jedes Projekt hat sich als Werbung für uns erwiesen, besonders natürlich die Ausstellungsräume, da dort die öffentliche Wahrnehmung sehr groß ist. PR im herkömmlichen Sinne machen wir nicht. Ich würde auch nicht sagen, wir wären ein auf Ausstellungen spezialisiertes Büro. Ich würde sagen: Wir sind ein an Ausstellungen interessiertes Büro. Uns interessiert das Ausstellen auch als Modellfall von Raum.
Wie entsteht aus einem Objekt und einem Kontext eine Spannung, die es zum Kunstwerk macht? Denn nicht das Objekt oder der Raum selbst macht es zum Kunstwerk, sondern eben diese Spannung. Wenn man nur mit Investoren oder Politikern zu tun hat, die nach ihrem jeweiligen Kalkül Dinge beauftragen, kommt man nicht auf so interessante Gedanken. Die Arbeit mit Künstlern, Kuratoren, Sammlern ist für uns sehr nahrhaft.
Was schätzen diese Künstler, Kuratoren und Sammler an eurer Arbeit?
Wir sammeln selber und sind mit Kunst vertraut, mit Künstlern befreundet, leben in diesem Bereich. Das drückt sich natürlich in der Architektur aus und wird von Künstlern und Sammlern verstanden. Ich kann mir vorstellen, dass es beruhigend ist für einen Sammler, wenn er ein Gegenüber hat, das seine Sprache spricht. Architekten sehen Kunst häufig anders. Das ist ganz natürlich. Der Architekt hat erstmal kein Problem damit, eine Schattenfuge mit Lüftungsschlitz zwischen Boden und Wand zu machen. Das kann man in den Museen der 1980er Jahre fast überall sehen. Für den Kurator und Künstler ist es ein Unding, dass die Wand einige Zentimeter über dem Boden schwebt und der Boden irgendwohin läuft. Für denjenigen, der in der Kunst arbeitet, müssen Wand und Boden zusammen treffen, muss sich dort eine Raumkante bilden. Wie soll ich sonst eine Fettecke ausstellen? Wie soll ich sonst das Gefühl erzeugen: Ein Bild hängt an einer Wand, die Wand steht auf dem Boden, auf dem Boden stehe ich?

Neben euren Umbauten für die Kunst habt ihr auch Neubauten realisiert: Einfamilienhäuser in Freiburg, Tübingen und Wien, eine Schule in Wien. Diese Häuser sprechen eine verwandte Sprache. Lassen sie vermuten, wie ein Museumsneubau von Kuehn Malvezzi aussehen würde?
Man kann, glaube ich, nicht einfach vom einen aufs andere schließen. Was uns jedoch interessiert ist zum Beispiel die Körperhaftigkeit: ein starker Baukörper und eine starke Körperform. Eine einfache Geometrie, geschlossene Oberflächen, wenig Nähte, auch eine «Detaillosigkeit», keine sichtbaren Verbindungen – «Lust am Verbergen» hast du das eben genannt, nicht alles transparent zu machen, sondern so etwas wie einen guten Anzug zu schaffen, in dem dann auch ein schöner Körper sein kann, den man zwar ahnt, aber nicht sofort sieht. Und eine Raumfolge, die sich wie ein Film durch die Bewegung darin entfaltet. Diese Qualitäten muss der Neubau eines Museums haben.
Das Gespräch führte Axel Simon.
Axel Simon, geboren 1966, schreibt in der internationalen Fach- und Publikumspresse über Architektur. Er lebt mit seiner Frau und seinen zwei Söhnen in Zürich.
www.architekturtexte.ch
Projektleitung: Andrea Nakath